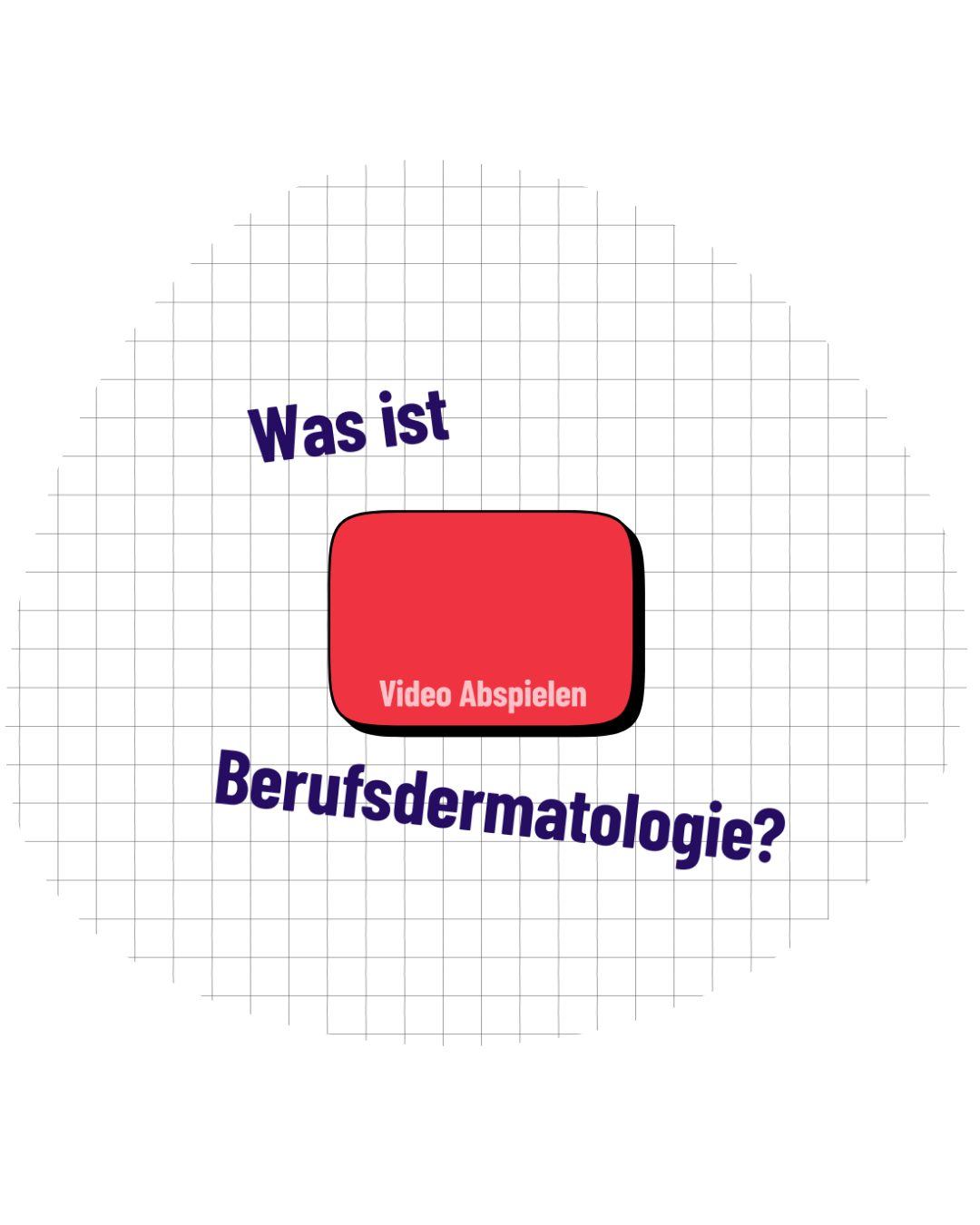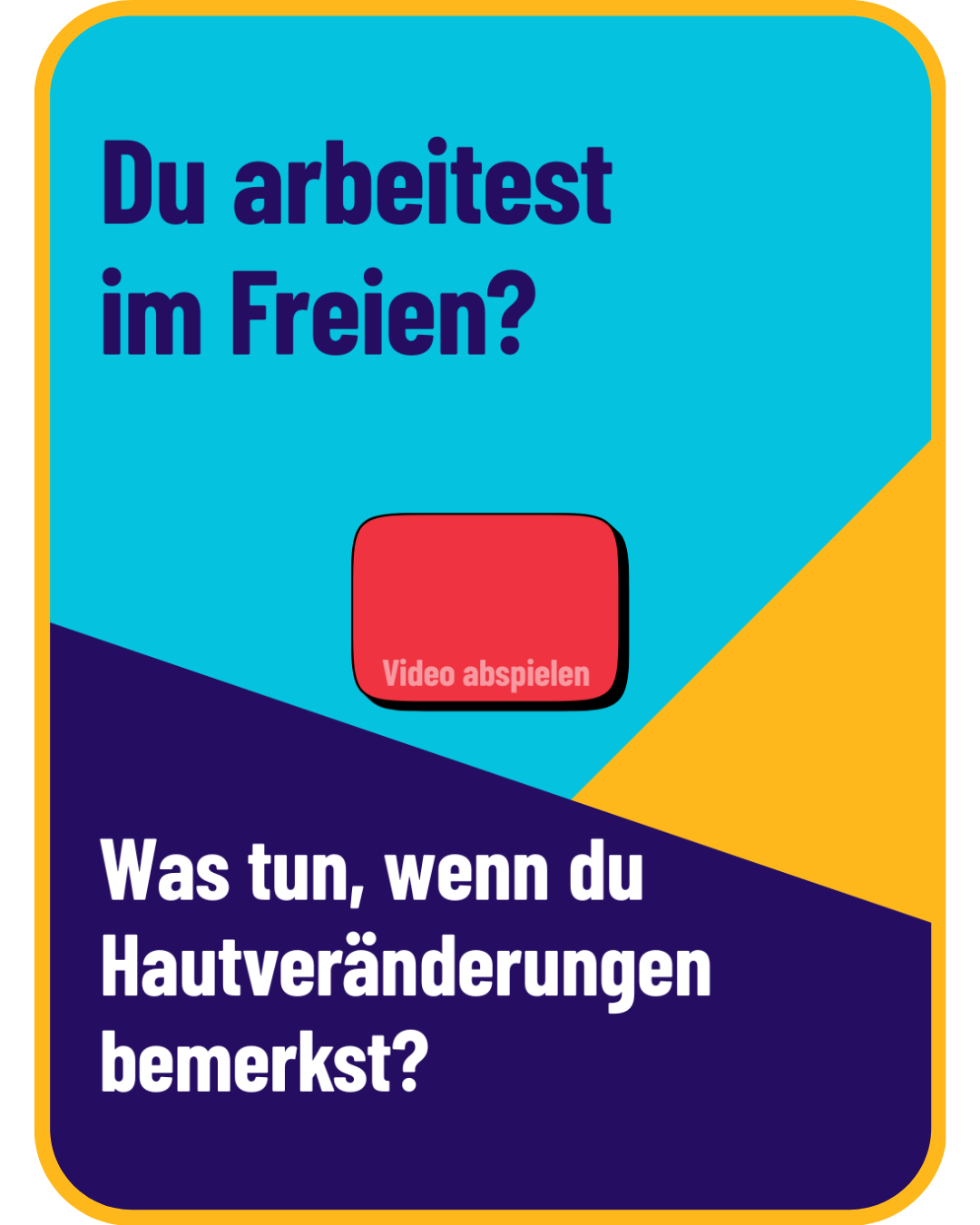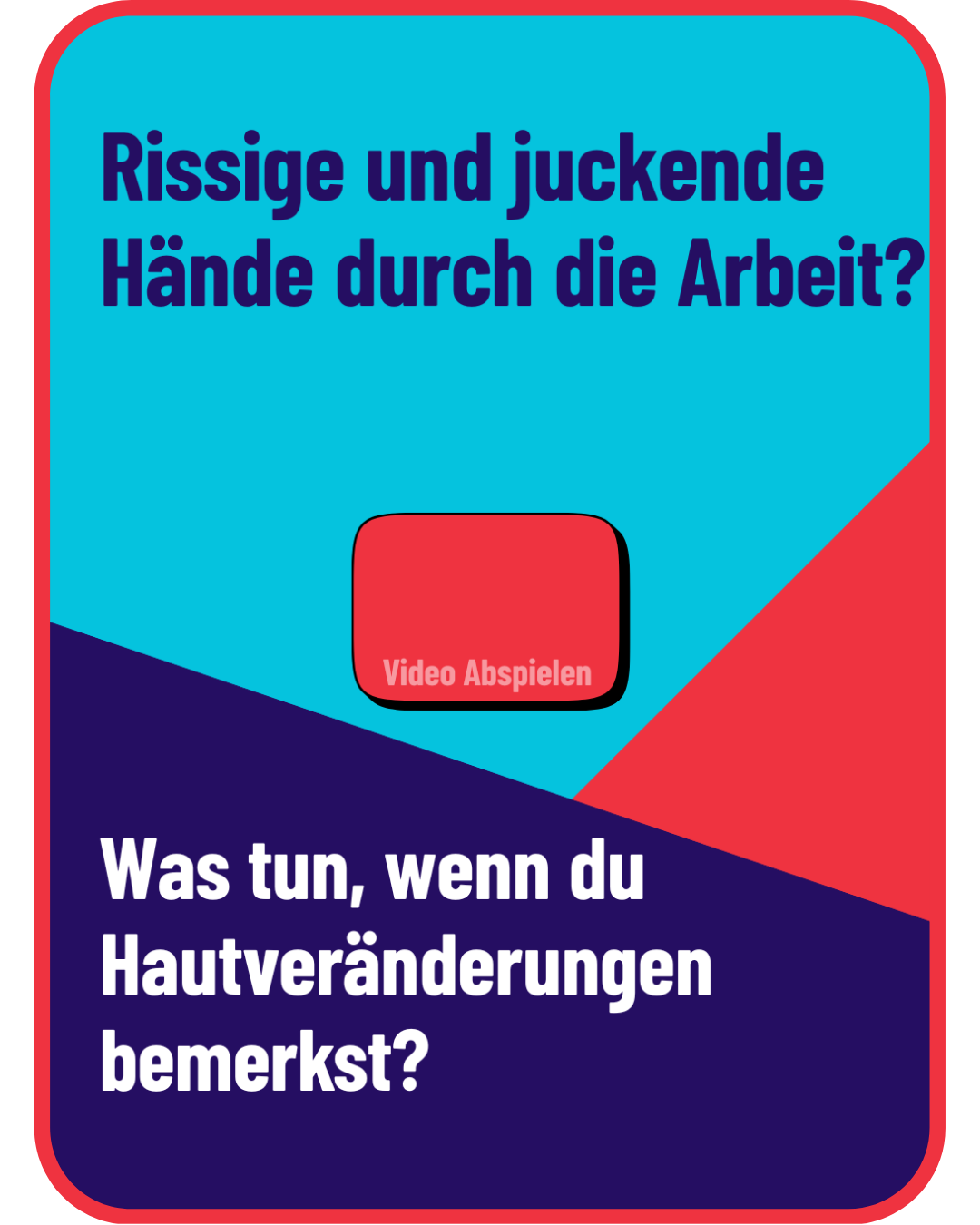Hilfe für Betroffene
Du brennst für deinen Job. Deine Haut auch?
Deine Arbeit wird dich noch viele Jahre begleiten. Warte nicht, bis kleine Hautbeschwerden zu einer chronischen Erkrankung werden, die dich im Berufsleben stark einschränken könnten. Handle frühzeitig: Kläre deine Beschwerden ab und nutze dermatologische Frühintervention oder Beratungsangebote deiner zuständigen Betriebsärzt:innen, bevor es ernst wird. So sicherst du dir langfristig deine Gesundheit – und bleibst in deinem Beruf.
Wichtig zu wissen: Schon leichte Hautbeschwerden können sich bei dauerhafter Belastung zu chronischen Hauterkrankungen entwickeln. Wer seine Gefährdung kennt, kann durch frühzeitigen Hautschutz und Prävention schwerwiegende Erkrankungen vermeiden.
UV-Schutz am Arbeitsplatz
Wenn du draußen arbeitest, bist du regelmäßig der Sonne ausgesetzt – und damit auch einem erhöhten Risiko für Hautschäden und Hautkrebs. Die Unfallversicherungsträger setzen deshalb auf Prävention: Hautkrebs durch UV-Strahlung am Arbeitsplatz zu verhindern, hat Priorität. Doch auch du selbst kannst eine Menge tun, um deine Haut langfristig zu schützen.
So schützt du deine Haut effektiv!
Denke daran: Nur eine kleine UV-Lichtmenge führt nicht zu langfristigen Schäden an der Haut. Die Eigenschutzzeit deiner Haut ist begrenzt. Deshalb gilt:
Schatten suchen: Vermeide direkte Sonne, auch im Schatten wirkt UV-Strahlung auf dich ein – jedoch weniger intensiv.
Mittagszeit meiden: Zwischen 11 und 15 Uhr ist die Sonne am stärksten – bleib, wenn möglich, im Schatten oder drinnen.
Passende Kleidung tragen: Ideal ist längere Kleidung, die auch häufig unbedeckte Körperpartien wie Dekolleté und Arme bedeckt.
Sonnenbrille aufsetzen: UV-absorbierende Gläser schützen deine Augen.
Kopfbedeckung nutzen: Am besten mit breiter Krempe oder Nackenschutz, um Gesicht, Ohren und Nacken zu schützen.
Sonnenschutzmittel verwenden: Creme unbedeckte Hautstellen mit einem Sonnenschutz ein, der sowohl UV-A- als auch UV-B-Filter enthält. Vergiss dabei empfindliche Stellen wie Nase, Ohren, Nacken oder die Kopfhaut nicht.
Rechtzeitig auftragen: Mindestens eine halbe Stunde, bevor du in die Sonne gehst. Regelmäßig nachcremen, besonders bei schweißtreibender Arbeit.
Schon gewusst? Nachcremen verlängert nicht die Schutzzeit, es stellt nur den ursprünglichen Schutz wieder her. Außerdem können manche Medikamente die Haut lichtempfindlicher machen – frage ggf. bei der Verordnung dazu nach!
Mit diesen einfachen Maßnahmen senkst du dein Risiko deutlich und sorgst dafür, dass deine Haut gesund bleibt – auch wenn du jeden Tag draußen arbeitest. Mehr zum Thema Sonnenschutz und Hautkrebsprävention findest du außerdem auf www.gemeinsam-gegen-hautkrebs.de
Ansprüche und Leistungen von der Unfallversicherung
Die Behandlungsoptionen durch die gesetzliche Unfallversicherung gehen über die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus. Dies gilt auch für Betroffene, die bereits aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind.
Mögliche Leistungen im Überblick:
Kostenübernahme: Heilbehandlungskosten werden von der gesetzlichen Unfallversicherung übernommen.
Entfall von Zuzahlungen: Zuzahlungsgebühren für Medikamente und Verordnungen entfallen.
Kostenlose Beratungsangebote: Anspruch auf Beratungen wie Hautschutzberatung, Arbeitsplatzbegehung und/oder Optimierung des Tätigkeitsprofils.
Reha-Maßnahmen: Anspruch auf stationäre Reha-Maßnahmen bis hin zur Umschulung, falls erforderlich.
Rentenanspruch: In besonderen Fällen besteht Anspruch auf eine Rentenzahlung.
Therapie und Unterstützung
Neben modernen, individuell abgestimmten Therapiemöglichkeiten ist die Kombination mit der Basistherapie essenziell. Dazu zählen Hautschutz- und Hautpflegeprodukte, die nicht verschreibungspflichtig sind. Bei einer anerkannten Berufskrankheit übernimmt in der Regel die gesetzliche Unfallversicherung die Kosten für diese Produkte.
Hautschutzbarriere erhalten
Unsere Haut schützt uns mit einer natürlichen Barriere aus Hornschicht, Hydrolipidfilm und Säureschutzmantel. Wer häufig mit Wasser oder gar Reinigungsmitteln hantiert, wer im Job viel Feuchtarbeit verrichtet oder mit hautschädigenden Substanzen arbeitet, kann die Regenerationsfähigkeit der Haut überfordern: Die Haut trocknet aus und wird spröde, rötet sich und schuppt. Typische Folgen und erste Anzeichen eines Handekzems sind trockene, rissige und gerötete Haut. Auch Allergene dringen leichter ein.
Was hilft? So kannst du Handekzemen vorbeugen:
Händewaschen vermeiden, Händedesinfektion bevorzugen
Hände mit pH-neutralen Syndets statt Seife reinigen, gut abspülen & vollständig abtrocknen
Keine Bürsten oder Handwaschpasten, wenn nicht unbedingt notwendig
Regelmäßig mit Pflegecreme eincremen, abends ggf. Creme mit Wirkstoffen wie Harnstoff verwenden
Bei Belastung: Schutzhandschuhe tragen
Bei Feuchtarbeit: gefütterte Gummihandschuhe, Latexfrei für Allergiker
Aggressive Stoffe vermeiden – direkter Hautkontakt schadet
Schon gewusst? Der Arbeitgeber ist verpflichtet, geeignete Hautschutzmaßnahmen wie z. B. Schutzhandschuhe, Hautschutz- und Hautpflegemittel bereitzustellen, wenn Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit einer Hautbelastung ausgesetzt sind.
Bin ich gefährdet?
Berufsbedingte Hauterkrankungen zählen zu den häufigsten Berufskrankheiten in Deutschland. Viele Betroffene merken erst spät, dass ihre Arbeit die Haut stark belastet – dabei bringt jede Branche typische Risiken mit sich.
Gefährdete Berufsgruppen sind unter anderem:
Pflege & Medizin durch ständiges Händewaschen, Desinfektionsmittel und Handschuhe belasten die Haut.
Handwerk durch Kontakt mit Staub, Farben, Lacken, Ölen und Chemikalien.
Bau & Gartenbau durch tägliche UV-Strahlung, Zementstaub, Feuchtigkeit und wechselnde Witterung.
Gastronomie & Reinigung durch intensive Feuchtarbeit, aggressive Reinigungsmittel.
Landwirtschaft durch Sonne, Pflanzenstoffe und mechanische Belastungen durch Arbeit im Freien.
Welche Tätigkeiten gefährden die Haut?
Feuchtarbeit: Häufiges Händewaschen, ständiger Kontakt mit Wasser oder langes Tragen von Handschuhen.
Chemische Belastung: Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Öle, Lösungsmittel oder Baustoffe.
UV-Belastung: Arbeiten unter freiem Himmel mit direkter Sonneneinstrahlung.
Mechanische Belastung: Reibung, Druck oder häufiges Tragen schwerer Arbeitsmaterialien.
Wichtig zu wissen: Schon leichte Hautbeschwerden können sich bei dauerhafter Belastung zu chronischen Hauterkrankungen entwickeln. Wer seine Gefährdung kennt, kann durch frühzeitigen Hautschutz und Prävention schwerwiegende Erkrankungen vermeiden.
Was tun bei Beschwerden?
Dein erster Ansprechpartner ist der Betriebsarzt oder die Betriebsärztin. Dort kannst du deine Beschwerden schildern und abklären lassen, ob es sich um eine berufsbedingte Hauterkrankung handelt.
Du hast außerdem die Möglichkeit, deinen Verdacht direkt bei deiner zuständigen Unfallversicherung zu melden. So wird sichergestellt, dass der Fall offiziell geprüft und die passenden Maßnahmen eingeleitet werden.
Die entsprechenden Formulare findest du auf der Website deiner zuständigen Berufsgenossenschaft. Eine Meldung ist für Sie kostenfrei und kann helfen, frühzeitig Unterstützung und Leistungen zu erhalten.
Natürlich kannst du dich auch jederzeit an eine Dermatologin oder einen Dermatologen wenden. Fachärztliche Beratung ist besonders wichtig, wenn die Hautprobleme nicht von allein abklingen oder sich sogar verschlimmern.
Unabhängig davon, wen du kontaktiert hast (siehe oben), wird zunächst die Vorgeschichte der Hautprobleme erhoben, besonders in Bezug auf den Arbeitsplatz. Typische Hinweise auf eine berufliche Ursache sind z. B. Besserung der Symptome im Urlaub oder an arbeitsfreien Tagen.
Anschließend folgen Untersuchungen des Hautbilds, ggf. Allergietests (Kontaktallergie mit Epikutantest, Soforttyp-Allergie mit Pricktest oder Antikörper-Messung im Blut) sowie ggf. Messungen zur Hautphysiologie (z. B. Schwitzneigung).
Wenn nötig kann auch der Präventionsdienst der Berufsgenossenschaft zur Beurteilung des Arbeitsplatzes einbezogen werden.
Das Hautarztverfahren dient der frühzeitigen Erkennung und Prävention berufsbedingter Hauterkrankungen gemäß §3 Berufskrankheitenverordnung. Es wird eingeleitet, wenn ein Verdacht auf eine beruflich verursachte Hautveränderung besteht. Ziel ist ein Verbleib der Betroffenen im Beruf.
(ausgenommen: Hautkrebs, infektiöse Krankheiten, Atemwegserkrankungen).
Ein Hautarzt oder Arbeitsmediziner erstellt einen Bericht mit Diagnose, beruflicher Anamnese und Therapieempfehlungen. Ziel ist eine möglichst nebenwirkungsarme Behandlung und die Teilnahme an Hautschutzschulungen.
Bei chronischen oder therapieresistenten Fällen greift die tertiäre Prävention, z. B. durch stationäre Behandlung mit medizinischer Begleitung bei der Wiedereingliederung in den Beruf.
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen sind Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Sie übernehmen eine zentrale Rolle bei berufsbedingten Hauterkrankungen:
Kostenübernahme: Sie finanzieren das Hautarztverfahren, inklusive Diagnostik, Therapie und Präventionsmaßnahmen.
Koordination: Sie beauftragen und steuern medizinische Maßnahmen (z. B. Schulungen, stationäre Behandlungen wie das „Osnabrücker Modell“).
Sicherung der Erwerbsfähigkeit: Ziel ist es, Betroffene im Beruf zu halten und chronische Erkrankungen zu verhindern.
Leistung bei anerkannter Berufskrankheit: Bei anerkannter Berufskrankheit zahlen sie Heilbehandlung, ggf. Verletztengeld, Umschulung oder Rentenleistungen.
Kurz gesagt: Sie sorgen für medizinische Versorgung, Prävention und soziale Absicherung – damit du trotz Hauterkrankung im Beruf bleiben kannst.
Wenn du eine berufsbedingte Hauterkrankung vermutest, solltest du diese unbedingt melden, denn deine Gesundheit steht an erster Stelle.
- Keine Nachteile im Beruf: Eine Meldung darf weder deine Arbeit noch deine berufliche Zukunft beeinträchtigen. Ziel ist es, deine Gesundheit zu sichern und rechtzeitig geeignete Maßnahmen einzuleiten.
- Datenschutz garantiert: Du hast die Wahl, wie du die Meldung machst.
- Meldest du die Hauterkrankung direkt bei deiner Unfallversicherung oder über eine Dermatologin bzw. einen Dermatologen, erfährt dein Arbeitgeber nicht automatisch davon. Du kannst eine Information des Arbeitgebers über deine Hauterkrankung verweigern. Allerdings kann dann unter Umständen kein optimierter Hautschutz erreicht werden.
Bis 2021 galt der sogenannte Unterlassungszwang. Dies bedeutete, dass berufliche Hauterkrankungen nur dann formal als Berufserkrankung anerkannt werden konnten, wenn die berufliche Hauterkrankung zur Berufsaufgabe gezwungen hat und die Tätigkeit auch tatsächlich aufgegeben wurde.
Heute hat sich dies geändert:
Arbeiten trotz Erkrankung: Auch bei Fortsetzung der beruflichen Tätigkeit ist die Anerkennung als Berufskrankheit möglich. Die betroffenen erhalten im Rahmen der Anerkennung die notwendige Unterstützung, um möglichst beschwerdefrei im Beruf zu bleiben.
Ziel der Unterstützung: Liegt eine anerkannte Berufskrankheit vor, besteht das vorrangige Ziel, die Folgen der Erkrankung zu mildern und eine Verschlimmerung zu vermeiden. Kann die berufliche Tätigkeit aus medizinischen Gründen nicht fortgesetzt werden, werden berufliche Rehabilitationsmaßnahmen, Übergangsgelder und gegebenenfalls Rentenzahlungen geleistet.
Damit wird deutlich: Auch mit einer berufsbedingten Hauterkrankung ist eine berufliche Zukunft möglich – begleitet durch gezielte Prävention, medizinische Betreuung und Hautschutzmaßnahmen.